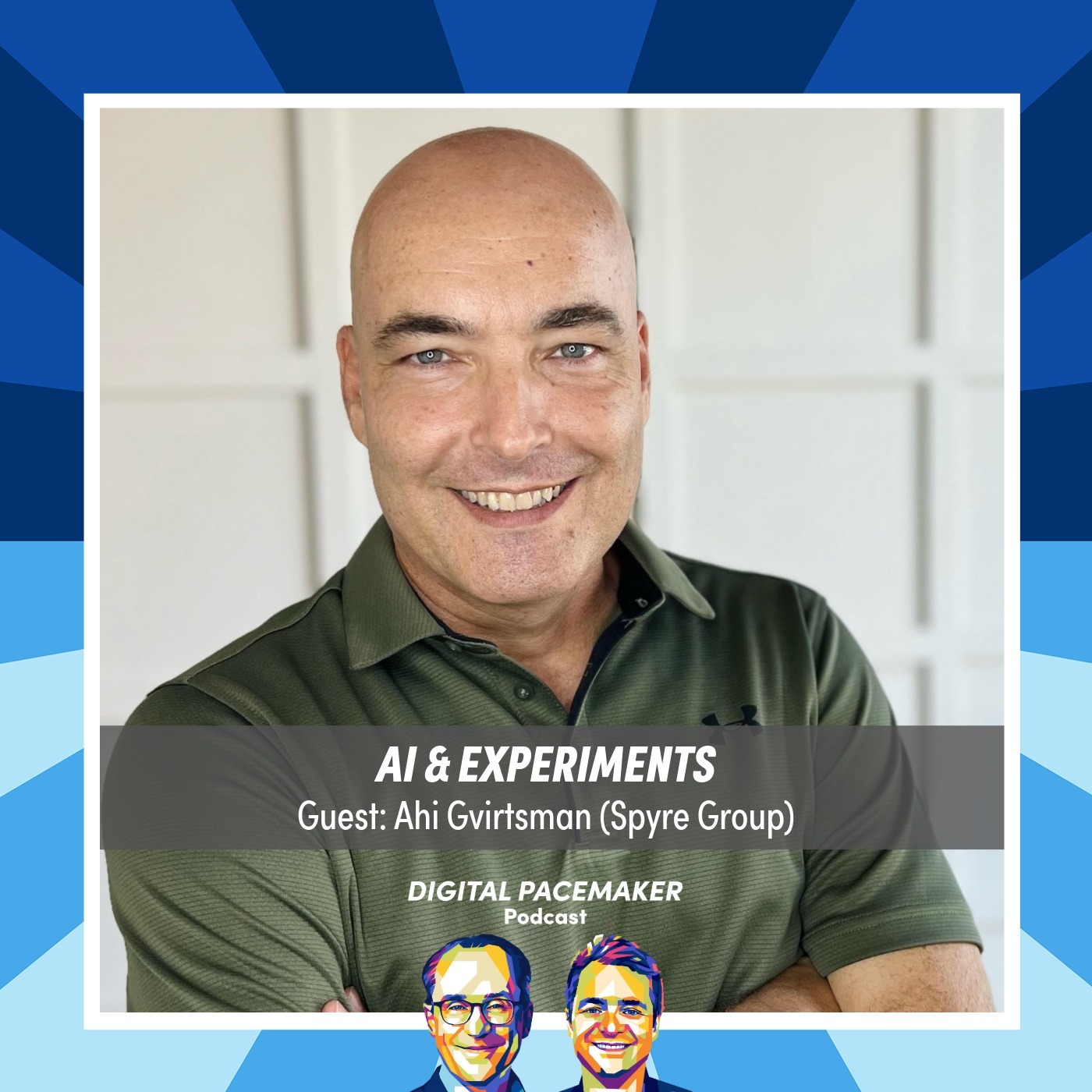mit Ulrich Irnich & Markus Kuckertz
Shownotes
Folge #18 behandelt das Thema “Machine Learning und wie man damit bessere Entscheidungen trifft“. Zu Gast ist dazu Mark van der Pas, CEO von Uffective.
Mark und seine Kollegen bei Uffective bieten Lösungen für das Portfoliomanagement an und unterstützen Unternehmen dabei, diese anzupassen und zu implementieren, um IT-Portfolios, Projekte und Prozesse transparent zu steuern und in vielfacher Hinsicht zu optimieren.
Uli, Markus und Mark diskutieren Anwendung und Vorteile – wie auch die Chancen mit ihr Wertschöpfung und Risikostreuung zu verbessern. Marc geht noch weiter und erläutert, dass der Einsatz von Machine Learning im Portfoliomanagement sogar Vorhersagen zum Projekterfolg liefert, die Entscheidungsfindung unterstützt – und dabei Mitarbeiter motiviert hält: „…es ist wichtig die Leute begeistert zu halten, weil die nächste Idee von ihnen… ist vielleicht die Idee, die den größten Beitrag liefern kann.“
Euer Feedback zur Folge und Vorschläge für Themen und Gäst:innen sind sehr willkommen! Vernetzt euch und diskutiert mit:
- Mark van de Pas: https://www.linkedin.com/in/mark-van-der-pas-40b39220/
- Ulrich Irnich: https://www.linkedin.com/in/ulrichirnich/
- Markus Kuckertz: https://www.linkedin.com/in/markuskuckertz/
Mitwirkende – Hosts: Ulrich Irnich & Markus Kuckertz // Produktion: Daniel Sprügel & Sören Wahlers, Maniac Studios (https://maniacstudios.com) // Redaktion: Marcus Pawlik // Kommunikation & Community: Anna-Lena Sodies // Team behind the team: Sonja Uller © Digital Pacemaker Podcast 2022
Zusammenfassung
In dieser Episode des Digital Pacemaker Podcasts sprechen wir mit Marc van der Paas, CEO von UFACTIV, über das faszinierende Thema Machine Learning und dessen Potenzial zur Verbesserung von Entscheidungsprozessen im Portfolio-Management. Marc und sein Team bieten Unternehmen Tools, um ihre IT-Portfolios transparent zu steuern und zu optimieren, was vor allem in Zeiten komplexer Projekte von großer Bedeutung ist. Wir diskutieren, wie die Nutzung von Daten und Machine Learning Unternehmen dabei helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen und Ressourcen effizient zu nutzen.
Das Gespräch beginnt mit den Herausforderungen, die das Portfolio-Management mit sich bringt, insbesondere in großen Unternehmen, wo die Vielzahl an Projekten und deren Abhängigkeiten schnell unübersichtlich werden kann. Wir beleuchten, wie Machine Learning nicht nur hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, sondern auch dazu beiträgt, die Konsequenzen von Veränderungen innerhalb des Portfolios transparent zu machen. Durch die Verwendung von Daten lässt sich verstehen, welche Strategien angeschlagen sind und wo Handlungsbedarf besteht.
Marc erklärt zudem, dass Portfolio-Management nicht nur eine Frage der richtigen Investitionen ist, sondern auch der Verbesserung der Wertschöpfung und der Risikostreuung. Anhand von Thesen, die wir gemeinsam besprechen, wird deutlich, wie wichtig es ist, die richtige Balance zwischen Investitionen und Ressourcen zu finden, um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen. Wir diskutieren, wie Unternehmen mit Machine Learning vor dem Projektstart wertvolle Vorhersagen über den Erfolg oder Misserfolg von Initiativen treffen können, was zu einer signifikanten Effizienzsteigerung führt.
Ein zentraler Punkt des Gesprächs ist die Notwendigkeit, Vorbehalte gegenüber Machine Learning abzubauen. Im Kontext von datenbasierten Entscheidungen stellt Marc klar, dass diese Algorithmen eine objektive Perspektive liefern können, die den Entscheidungsfindungsprozess im Board bereichert. Der Einsatz von Machine Learning sollte nicht dazu führen, dass menschliche Intuition und Erfahrung außen vor gelassen werden, sondern vielmehr als ergänzende Informationsquelle genutzt werden.
Marc beschreibt auch, wie Daten aus der Vergangenheit analysiert werden können, um Muster zu erkennen, die Aufschluss über den Verlauf von Projekten geben. Diese objektiven Daten können helfen, die Gesundheit eines Projekts während seiner Laufzeit zu überwachen und so frühzeitig auf mögliche Probleme zu reagieren.
Abschließend ermutigen wir die Zuhörer, sich mit dem Thema Machine Learning auseinanderzusetzen und die Möglichkeiten zu erkunden, die es bietet, um die Effizienz in ihren eigenen Unternehmen zu steigern. Wir erfahren von Marc, dass auch in der IT-Welt nicht alles gleich ist und dass man sich nicht scheuen sollte, Technologien und Modelle zu adaptieren, um eine bessere Zukunft zu gestalten.
Durch diese Episode wird deutlich, dass der Einsatz von Machine Learning nicht nur technologische Entwicklungen vorantreibt, sondern auch tiefere Einblicke in die Unternehmenskultur und Entscheidungsfindungsprozesse ermöglicht.
Transkript
Speaker0:[0:00] Also es ist wichtig, Nein sagen zu können, ohne Menschen damit zu beschädigen, ohne Menschen damit zu verlieren. Und das ist eine Aufgabe vom Portfolio-Management. Organisiere es so, dass du die Leute dabei behältst.
Music:[0:13] Music
Speaker2:[0:28] Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit euren Gastgebern Uli Oehlich und mir, Markus Kuckertz. Wir sprechen heute über Machine Learning und wie man damit bessere Entscheidungen treffen kann. Zu Gast haben wir dazu Marc van der Paas, CEO von UFACTIV. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten auch schon mal Markus Lause zu Gast zum Thema OKR, auch von UFACTIV. Und wir dachten, weil das Thema sehr gut angekommen ist, lasst uns doch auch mal über das Thema Machine Learning sprechen. Und ich freue mich heute, Marc, dass du unser Gast bist. Herzlich willkommen.
Speaker0:[0:56] Ich habe zu danken.
Speaker2:[0:57] Marc und seine Kollegen bei UFACTIV bieten Lösungen für das Portfolio Management an und unterstützen Unternehmen dabei, diese anzupassen und zu implementieren, um IT-Portfolios und Prozesse transparent zu steuern und in vielfacher Hinsicht zu optimieren. Und Uli, uns beschäftigt das Thema Portfolio-Management auf der einen Seite natürlich immer wieder, vor allem wenn es um das Thema Investitionen geht oder Priorisierung, aber natürlich auch das Thema Machine Learning. Ja, was mich natürlich da interessieren würde, Uli, welche Herausforderungen siehst du bei diesem ganzen Themenkomplex und was ist das, was dich da vielleicht besonders heute mit dem Markt interessiert?
Speaker1:[1:31] Also das erste Thema ist natürlich, dass wir mit Daten und Machine Learning natürlich bessere Entscheidungen treffen können. Das sagt ja auch schon so ein bisschen die Headline. Und ich glaube, bei so einem großen Portfolio, und gerade wenn es ein Stück weit unübersichtlich wird, ist natürlich wichtig zu verstehen, was habe ich eigentlich für Optionen? Und wenn ich so eine Option entscheide, was hat dann das für eine Konsequenz? Also ich sage mal, wenn du jetzt nur drei Bausteine hast und musst davon eine verschieben, dann ist das noch relativ leicht zu verstehen.
Speaker1:[1:59] Aber stellt euch mal vor, ihr kippt jetzt eine Lego-Kiste aus, da sind 3000 solcher Bausteine drin. Und die hängen auch noch miteinander zusammen. So, und wenn ihr jetzt dieses Spinnengewebe anfangt zu verschieben, dann ist es, glaube ich, nicht unbedingt, also zumindest mein Gehirn schafft das nicht, zu verstehen, was das für eine Konsequenz hat. Und ich glaube, das auch transparent darzustellen und auch grafisch darzustellen, sodass es für uns Menschen nachvollziehbar ist, was das für Konsequenzen hat, gerade in so Szenarien ausgehend, Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was dahinter ist. Und ich glaube, wir lösen auch heute so ein bisschen das Mystische im Machine Learning auf. Und ich glaube, da stecken ja wie immer manchmal auch so ein paar Mythen drin. Ich glaube, mit denen brechen wir heute in dem Gespräch mit Marc. Und ich glaube, das ist in Summe ein gutes Thema, was wir heute haben. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du heute da bist, lieber Marc. Und ich stelle dich kurz vor, bevor wir in MediaRes und quasi in alle die Details einsteigen. Marc van der Paas, seit 2014 ist Marc bei der YouFactive zunächst als Gründer und Managing Director, heute CEO.
Speaker1:[3:06] Davor war Marc 20 Jahre bei Vodafone. Was für ein Zufall. Zuerst in der Niederlassung, später in Düsseldorf und dann nachher in London. Also eigentlich kennt Marc alle Stationen der Vodafone in verschiedenen Rollen der IT, der Strategie und dem Marketing. Nach seinem BWL-Studium und IT-Studium in Herlen, Hasselt und Groningen war Marc fünf Jahre Marineoffizier, wo er sich mit Logistik und Metadatenmanagement beschäftigt hat. Und darauf kommen wir gleich nochmal ein bisschen. Also daher erstmal herzlich willkommen, lieber Marc. Und bevor wir ins Detail gehen, Marc, erzähl doch mal so ein bisschen, woher kommt denn deine Leidenschaft überhaupt für das Zeug her? Also ich meine, wird man da wach und sagt, jetzt bin ich Machine Learning Addicted oder wie passiert sowas?
Speaker0:[3:48] Also du hast es, denke ich, glaube ich, schon angedeutet, Uli. Die Herausforderung beim Portfolio-Management ist sehr, sehr groß. Also da gibt es wahnsinnig viele Datenpunkte und es ist egal, wie fleißig man ist, man kann nicht all diese Datenpunkte als Mensch zu sich nehmen und daraus dann ein Bild schaffen und von daraus sagen, okay, wie kann ich mit meinem Portfolio jetzt die größte Wirkung erzeugen. Das heißt, ich brauche Instrumente und Machine Learning ist da ein wunderschönes Instrument, weil anders als ich oder anders als die meisten Menschen kann eine Maschine einfach alles lesen und auch die Verbindungen zwischen den Komponenten einmal zu sich nehmen und dann von daraus starten.
Speaker2:[4:30] Und Marc, wir haben uns natürlich auch vorher mit dir beschäftigt und das Thema Portfoliomanagement ist im Jahr auch nicht ganz fremd. Ich habe mich auch ein paar Jahre damit beschäftigen dürfen. Und habe es nicht final ergründen können, weil es natürlich auch so eine Dynamik unterlegen ist. Und wir haben mal drei Thesen vorbereitet, die so ein bisschen wiedergeben, was dein Standpunkt zu dem Thema ist. Also du sagst, dass Portfolio-Management nicht nur die Transparenz und Steuerung, sondern auch die Verbesserung der Wertschöpfung und die Streuung von Risiko ermöglicht. Du empfiehlst darüber hinaus den Einsatz von maschinellem Lernen, weil dieses bereits vor dem Projektstart zuverlässige Vorhersagen zum Verlauf und zum Ergebnis ermöglicht. Und als dritten Punkt, plädierst du dafür, dass wir weniger Vorbehalte beim Einsatz vom maschinellen Lernen zur Entscheidungsfindung haben sollten? Und ja, um vielleicht auch mal ganz vorne anzufangen, wir reden jetzt die ganze Stunde von Portfolio-Management. Was versteht man in deinem Kontext unter Portfolio-Management? Vielleicht kannst du uns das kurz erläutern zu Beginn.
Speaker0:[5:25] Also ich sehe für Portfolio-Management drei Hauptaufgaben. Also als erstes, in meiner Sicht sollte Portfolio Management bestimmen, wie viel wir in IT investieren. Und es handelt sich dann nicht nur um die Anzahl der Euros, sondern auch, wie viele Fachkräfte sind notwendig, um die Herausforderung, die da liegt, anzugehen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, denke ich, wenn man das dann weiß, dann muss man bestimmen, welche Projekte man macht oder im Agile-Umgebung, welche Value Streams man haben möchte und wie viele Mittel man diese zur Verfügung stellt. Das ist, denke ich, die zweite Aufgabe. Und durch die zweite Aufgabe entsteht auch ein Portfolio. Ein Portfolio von Projekten oder ein Portfolio im Agile-Umfeld von Value Streams. Die dritte Aufgabe ist, denke ich, die Effizienz aller Projekte. Also nicht von einem Projekt, also nicht versuchen, ein Projekt schnell effizient durchzuziehen, aber eine Umgebung zu schaffen, wo alle Projekte, die priorisiert werden, effizient umgesetzt werden können.
Speaker2:[6:30] Uli, wenn du dir das als Steuerungsinstrument so nimmst und einmal die Verknüpfung von vielleicht Unternehmenszielen zu dem, was du jeden Tag an Entscheidungen treffen musst siehst, was hat das für dich für einen Effekt? Wo liegt für dich da vielleicht der Schwerpunkt oder auch so in der täglichen Nutzung der größte Nutzen in diesem Instrument?
Speaker1:[6:46] Vielen Dank, Markus. Wenn wir mal rein von so einem Portfolio-Planungsevent herkommen und planen Dinge, dann blenden wir immer kurzfristig aus, dass die Welt um uns herum einfach für die Zeit stillstehen bleibt. Das tut sie blöderweise aber nicht. Ja, also da kommen Außenparameter, die auf uns einwirken, sei es der Wettbewerb vielleicht einen Move macht, den wir nicht eingeplant haben,
Speaker1:[7:11] Dass plötzlich, ich sage mal, Prioritäten sich verschieben, weil gewisser Fokusbereich sich verändert hat oder halt auch Kundenanforderungen sich natürlich verändern und wir darauf logischerweise reagieren müssen. Und das ist die Herausforderung bei dem Portfolio-Management, zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt auf diese Veränderung kurzfristig ein? Und jetzt kommt es, die meisten können dann ihre Lego-Klötze verschieben, können aber nicht wirklich erklären, was das für Konsequenzen hat. Sowohl in Ressourcen, aber auch in der Steuerung deines Portfolios. Also gerade was Liefertermin und Co. angeht. Und daher ist es so entscheidend, genau diese Dimensionen mit zu berücksichtigen und die so transparent wie möglich zu machen. Weil ich glaube, auch für alle Beteiligten, je mehr Menschen in so einem Portfolio-Thema arbeiten, bis hin zum Entwickler, die müssen alle verstehen, dass wir gerade auf dieses Ziel steuern. Das ist das Entscheidende bei so einem Portfolio-Management. Das klingt jetzt so dahingeredet total trivial. Ich kann euch sagen, die meisten Portfolio-Managements sind nicht darauf vorbereitet, wenn sich kurzfristig dramatische Dinge draußen ändern. Sehe jetzt unsere Dinge, die sie in der Welt da so verändern, Energiekrisen, Inflationen, Kunden wollen plötzlich ganz andere Themen, dann zeigt sich ein gutes Portfolio-Management, wie schnell ich auf solche Dinge reagieren kann und auch meinen Kurs anpassen kann. Dafür nicht zwei Jahre brauche, bis es dann irgendwann mal passiert.
Speaker2:[8:41] Marc, ihr seid ja mit dem Portfolio-Management bei vielen Unternehmen unterwegs. Sind wir hier natürlich aus unserer Brille immer besonders mit der IT-Brille und dem Invest auf Projekte und technische Innovationen unterwegs. Und wenn man jetzt mal das so versteht, wie du es erklärt hast oder wie es aus deiner These hervorgeht, wenn es hier vor allem um Transparenz und Steuerung geht, wie geht es denn bei anderen Unternehmen zu? Wofür Nutzen dienen das Portfolio Management? Und ja, was für Nutzen hat das denn für andere Unternehmen vielleicht auch?
Speaker0:[9:09] Das Thema Portfolio-Management ist für viele Unternehmen echt eine riesige Herausforderung. Die zur Verfügung stehenden Mittel umzusetzen in einem effizienten Portfolio, das einen großen Wertbeitrag hat, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Was wir da sehen, ist, dass viele unterwegs sind auf einer Reise und die Reise, das Schöne davon ist, die Theorie dahinter ist schon bekannt. Der Markovic hat ja damals in den 50er schon erklärt, wie Portfolio Management zu tun ist. Er hat gesagt, es ist ganz einfach, was ihr da macht. Also ihr müsst zwei Achsen, also eine Figur mit zwei Achsen euch vorstellen. Einmal ist das Thema erwartete Wertschöpfung und die andere Achse ist das Thema Risiko. Und dann bildet ihr die Ideen ab auf diese beiden Achsen, optimiert dann mit einfacher Mathe das Modell und damit bestimmt ihr das effiziente Portfolio, so wie ihr das genannt habt. Und das ist das Wunderschöne. Die Theorie ist vorhanden, aber die Praxis ist so wahnsinnig schwierig. Die ist komplex für große Firmen. Also eine Firma, die mit zwei Projekten unterwegs ist, würde ich sagen, prima. Da brauchst du kein Portfolio-Management. Aber mach da mal 100 aus oder mach da mal 1.000 aus. Oder Kunden, die wir haben, die mehrere hunderte Millionen im Jahr investieren, die sind sehr daran interessiert, die Wirkung von jedem Euro oder auch jede Stunde, die Sie darin investieren, größer zu machen.
Speaker2:[10:38] Also es geht vor allem um Effektivität. Aber du hast jetzt auch gesprochen natürlich von der Verbesserung der Wertschöpfung einer Unternehmung und von der Risikostreuung. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Speaker0:[10:47] Eine Risikostreuung ist ein besonderes Ding. Also wenn wir bei Kunden sind, dann sehen wir bei dem Thema Risikomanagement sehr häufig die Ampeln. Also Rot, Gelb, Grün. Oder wir sehen auch, also die schon ein bisschen weiter sind, die haben dann Auflistungen von Risiken, die es gibt bei Investitionen. Und das sind dann Beschreibungen von was alles passieren kann, wenn eine Investition genehmigt wird. Das ist eine Art von Risikomanagement, da kann der Markowitz überhaupt nichts mit. Also der Markowitz hat gesagt, Risiko muss man bewerten, sag mal in einer Zahl, sag mal zwischen 0 und 1. Und dann kannst du nicht gelb, grün oder rot sagen, Sondern du musst sagen, wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir hier Geld und Mittel in die Hand nehmen, dass dann auch dabei rumkommt, was wir davon erwarten. Und da können wir mit Machine Learning, können wir echt sehr viel tun, was wir bis dato nicht gemacht haben. Also außer dieses System mit Red, Amber, Green und diese Auflistung, sehen wir auch, dass Menschen, also die Erfahrung von Menschen im Board, wird dann eingespielt. Also ich glaube daran, wird dann gesagt. Oder ich glaube nicht daran. Also das ist dann eher die menschliche Komponente, die er reinbringt. Auch da hat Markovic wieder seine Probleme, weil ich glaube daran oder ich glaube nicht daran, kann man nicht anwenden, um ein Portfolio zu optimieren.
Speaker2:[12:05] Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu veranschaulichen, lass uns vielleicht mal in so ein Beispiel gehen. Also ich bin vielleicht eine glückliche Unternehmung, die 100 Millionen Euro fürs nächste Jahr in der Hand hat, um mich weiterzuentwickeln und um vielleicht auch meine IT-Landschaft, meine Kundenerfahrung zu verbessern, um neue Produkte einzuführen. Ja, wenn ich jetzt aber dann natürlich auf der anderen Seite 300 Ideen habe, sage ich mal das Dreifache davon an Vorhaben habe, ja, was bietet dann das Prinzip? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären. Wie geht man denn da vor? Wie kann denn das dann einem Unternehmen helfen?
Speaker0:[12:33] Ja, das Erste, was ich sagen würde, ist, starte bitte nicht alle 300 zeitgleich. Weil dann bist du relativ sicher, dass da fast nichts bei rumkommt, weil jeder einander in den Wege läuft. Das haben wir aus der Logistik gelernt. Die Logistik hat sehr klar gemacht, du musst da Prioritäten setzen und die Maschine nur bespeisen mit einer bestimmten Anzahl. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man im Portfolio-Management tun muss. Was ist eigentlich die Menge, die wir verkraften können? Das ist eine komplexe Frage. Also was ist die optimale Menge, die wir als Organisation an Projekte, Investitionen umsetzen können? Wenn man das weiß, also das ist die erste Frage, dann geht man auf die zweite Frage, wie organisiere ich das jetzt? Und eine große Firma wie Vodafone, bei euch gibt es ja so wahnsinnig viele Ideen. Die Kollegen, die rumlaufen, die sprudeln mit Ideen.
Speaker0:[13:24] Und das ist auch gut, nimm die Ideen auf, aber die können nicht alle umgesetzt werden. Das heißt, irgendwie muss organisiert werden, welche von den Ideen aufgegriffen werden und welche nicht. Und dafür gibt es, sagt man, eine Organisationsstruktur, die man um Portfolio Management aufbaut. Zum Beispiel, leg nicht 300 Millionen Ideen auf ein Board-Meeting, würde ich nicht tun. Also Board-Meetings sind nicht geeignet, das haben wir gesehen, um zwei Drittel aller Vorschläge abzulehnen. Das machen die normal nicht. Das musst du anders organisieren. Und dann kannst du auch wieder das Thema Risikomanagement da reinbringen. Und damit kann man es auch objektivieren. Und das ist sehr günstig. Also wenn ein Kollege eine Idee hat, also in deinem Beispiel, müssten wahrscheinlich zwei Drittel der Ideen gestoppt werden. Das heißt, es gibt auch Menschen, die mit Ideen kommen, die davon begeistert sind, die die vorantreiben und die dann trotzdem nicht umgesetzt werden. Es ist wichtig, die Leute begeistert zu halten, weil die nächste Idee, womit sie kommen, ist vielleicht eine Idee, die umgesetzt werden kann und ist vielleicht auch die Idee, die die größten Beiträge liefern kann. Also es ist wichtig, Nein sagen zu können, ohne Menschen damit zu beschädigen, ohne Menschen damit zu verlieren. Und das ist eine Aufgabe vom Portfolio-Management. Organisier es so, dass du die Leute dabei behältst.
Speaker1:[14:47] Und das ist ein wichtiger Aspekt, Marc. Ich meine, dieses Nein-Rufen, alleine ist es nicht. Ich glaube, das abholen, genau wie du das beschreibst, aber auch die Transparenz zu haben, dass das jetzt in einem Güterbahnhof stehen bleibt, deswegen ist es nicht kaputt und nicht schlecht. Aber wir haben uns überlegt, es gibt ein paar andere Dinge, die wir jetzt schneller in den Markt bringen wollen und deswegen fokussieren wir uns darauf. Und ich glaube, das ist auch die Haltung, die dahinter steht, zu sagen, du bist dadurch kein Gewinner oder Verlierer, sondern dir ist klar, wie die Prioritäten sind und dein Ding ist im Backlog, damit ist es nicht tot, also ist es nicht weg. Und ich glaube, je mehr das in eine Organisation reinwächst, desto besser funktioniert auch ein Portfolio-Management.
Speaker2:[15:32] Uli, nun ist ja das Thema Objektivierung vielleicht auch eines der größeren Probleme, das wir haben, wenn wir solche Entscheidungen treffen. Und ich meine, bei dir ist das ja wirklich der totale Alltag, wirklich wahrscheinlich morgens vom ersten Call bis noch spät in den Abend, wenn du dir nochmal Gedanken machst, wo du sagst, naja, klar, wenn du natürlich objektive Daten hättest, um Entscheidungen zu treffen und das alles immer synchron läuft, wäre das natürlich einfach. Ach, nun ist das ja in der Praxis leider nicht immer so, wenn du in Meetings bist und nach Ressourcen gefragt hast. Es geht ja auch nicht immer nur um Geld, sondern auch um Lieferkapazitäten oder um Zuteilung von Menschen, die wirklich dann daran arbeiten. Was sind denn aus deiner Praxis so die Erfahrungen im Bereich der Objektivierung? Was für Probleme ergeben sich dort?
Speaker1:[16:13] Grundsätzlich ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass sie alle darauf einigen, wie man eine Bewertung durchführt. Also woran mache ich Kundenwert fest? Also schaffe ich mit dieser Lösung einen Kundenvalue? Schaffe ich damit Einsparungen zu betreiben? Diese Einigung auf die gemeinsame Währung, so leicht sich das auch hinrichtet, das ist wichtig. Sobald die akzeptiert ist, ist die Entscheidung entlang dieser Währungen eigentlich ziemlich einfach. In den meisten Situationen hat genau diese Einigung noch nicht stattgefunden und deswegen gibt es halt da Reibereien. Ich meine, wir alle kennen Business Cases, das sind diese sogenannten Papiere, mit denen ein Investitionsvorhaben gut gerechnet wird. Das kennen wir vom Berliner Flughafen, das kennen wir von anderen großen Projekten, die natürlich immer mit einem großen Glauben ausgestattet werden. Und die muss man ein Stück weit beiseite legen, weil Business Case ist nicht der Treiber für ein gutes Portfolio. Sondern die Frage ist halt, wie schaffe ich tatsächlich Kunden mehr Werte? Und wie bewerte ich die? Und wie schaffe ich die logischerweise einzusortieren?
Speaker1:[17:20] Weil ansonsten bist du relativ schnell in solchen, ich sage mal, wenn nicht alle Business Case zusammen addieren, waren die Unternehmen mindestens 100 Mal so viel wert, als bevor diese Business Case da waren. Blöderweise treten die Business Case aber nicht mal so ein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir, wenn wir klar denken, halt auch eine Abschichtung machen, was real und was nicht real. Und da helfen natürlich Daten, a, solche Cases zu validieren und vor allen Dingen halt auch ein Stück weit realistischer einzuschätzen. Und darum geht es ja auch am Ende des Tages ein Stück weit. Das ist emotional nicht trivial.
Speaker2:[17:58] Und damit kommen wir vielleicht auch schon zu dem Thema Machine Learning und vielleicht zu dieser Vorstellung einer wirklich, naja, einigermaßen idealen Welt. Marc, du sprichst von Vorhersagen bereits vor Start von Projekten, also von der Vorstellung, dass man vielleicht vorher schon eine objektivierte Wertung eines Vorhabens vornehmen kann. Da ergibt sich vielleicht schon mal so ein Problem, die meisten Dinge, die dann ja irgendwann so an die Öffentlichkeit innerhalb einer Unternehmung gespürt werden, die sind ja irgendwo schon mal auch so ein bisschen gestartet und da hat man sicherlich auch schon so ein bisschen was in die Idee investiert. Gibt es denn tatsächlich bereits vor Projektstart aus deiner Sicht nutzbare Daten, die einen Verlauf vorhersagen können? Und was sind das denn für Daten, mit denen man da arbeiten könnte, um vielleicht schon sehr frühzeitig zu sagen, naja, geht es denn in eine Richtung, wo es erfolgreich sein wird oder vielleicht eher nicht?
Speaker0:[18:45] Also da habe ich viel von der ING-Bank gelernt. Also die ING-Bank hat vor 20 Jahren eine Studie veröffentlicht, wo die gesagt haben, wir machen hier viele IT-Projekte und viele davon haben Budgetüberschreitungen. Und wir wollten eigentlich wissen, was sind jetzt die Variable, die zu dieser Budgetüberschreitung führen. Also was ist die Umgebung von Projekten, die Überschreitungen haben und was ist die Umgebung von Projekten, die keine Überschreitungen haben. Und das war eine Analyse, wo Sie mit sehr einfachem Mathe zum Fazit gekommen sind, dass zum Beispiel Projekte, die sehr transparent sind, was die Kosten angeht, eine viel niedrigere Wahrscheinlichkeit haben als Projekte, die die Kosten in zwei, drei Zeilen beschreiben. Oder auch, dass die Projekte, die von Bereichen kommen, wo sehr viele Leute arbeiten, auch von den größeren Bereichen, dass sie auch eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie zu Budgetüberschreitung führen. Und das würde man nicht direkt erwarten. Man erwartet also, wenn der Bereich groß ist, dann gibt es da mehr Expertise und dann wird wahrscheinlich auch das Thema Budgetüberschreitung besser im Griff sein. Und diese alte Studie hat bei uns vor sechs Jahren getriggert und gesagt, lass uns doch mit Machine Learning mal gucken und die Variable, die uns vorliegen, lass uns die mal anwenden, um damit ein Modell zu erstellen, das uns vorhersagt, welche Projekte gecancelt werden oder nicht.
Speaker0:[20:11] Und die gleiche Information, die ING geliefert hat, haben wir in den Modellen reingebracht. Also wie ist zum Beispiel die Transparenz von deinem Budget oder wie ist die Planung von deinem Projekt, also wie ist die Planung aufgeteilt. Die haben wir da reingesteckt, aber wir haben da zig Variablen, die wir wussten, haben wir reingesteckt und dann die Modelle rechnen lassen und dann gucken, was sind jetzt eigentlich die Variablen, die am meisten bestimmen, ob ein Projekt wahrscheinlich gecancelt wird oder nicht gecancelt wird.
Speaker2:[20:40] Und in dem Kontext kommt ja dann das maschinelle Lernen ins Spiel. Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Und ich denke es natürlich daran, man wird das ja wahrscheinlich auf Basis natürlich von Daten, die aus der Vergangenheit, aus Erfahrung nutzen. Ja, was kann ich denn da auch tun, dass ich da vielleicht nicht unbedingt, wenn ich diese Daten zur Grundlage nehme, eben Fehler, also Fehlentscheidungen repliziere und die dann natürlich als Grundlage nehmen für eine objektivierte sogenannte Zukunft?
Speaker0:[21:03] Wir fangen an mit Sammeln von Daten. Also was ist das Track Record von einer Organisation? und dann haben wir alle Projekte und die Daten, die zu den Projekten bekannt sind. Dann gucken wir darauf, was diese Features, die sogenannten Input-Features, welche das sind und wie wir die in dieses Modell reinbringen können und auch, was wir reinbringen dürfen. Also es gibt ja auch Sachen, die wir nicht reinbringen wollen. Also wenn ein Projektleiter mal ein Projekt verantwortet hat, das gescheitert ist, ist ja nicht gesagt, dass alle Projekte, die von diesem Projektleiter gemacht werden, scheitern werden. Also das ist, denke ich, wo du aufdeutest. Diese Art von Input darf man ja nicht in so ein Modell mit reinbringen. Aber was man reinbringen kann, zum Beispiel, wenn wir so ein Modell anwenden für laufende Projekte, ist, wie lange dauert es eigentlich, dass ein Projekt, das ein rotes Signal aufweist, dieses rote Signal auflöst. Also wie viel Zeit brauchen die dafür? Oder überhaupt, wie viele rote Signale kommen da? Weil es kann so mal sein, dass wenn keine roten Signale kommen, dass das das roteste Signal ist, was es gibt für ein Projekt. Also diese Art von Informationen suchen wir, bringen wir zusammen und da lassen wir die Modelle dann drauf laufen und gucken, inwieweit sie vorhersagen können, ob ein Projekt gecancelt wird.
Speaker0:[22:22] Das, was wir nicht können im Moment, ist, weil wir Daten immer von einem Kunden bearbeiten, ist die Projekte, die gecancelt werden, die eigentlich nicht gecancelt hätten, wären sollen. Also die false skills, also die gestoppt wären, aber die eigentlich ein Erfolg wären, die zu bewerten. Also was sind die Themen, die gestoppt wurden von Firmen, die eigentlich weitergemacht werden mussten? Das können wir jetzt noch nicht. Dafür muss man über Organisationen hinweg gucken können. und die Offenheit ist noch nicht da. Also wenn, sag mal, alle Telekom-Operators, dass die Daten auf den Tisch legen würden und wir sehen bei einem, dass ein Erfolg auftritt und bei anderen, dass die abgelehnt wurde, diese gleiche Art von Investitionen, dann können wir das machen. Aber diese Datentransparenz steht uns nicht zur Verfügung.
Speaker2:[23:08] Uli, der Marc hat das eben angesprochen, mit den Projekten, die nach außen immer grün aussehen, innen aber rot sind. Wir sprechen auch liebevoll von Melonenprojekten, was natürlich auch ein bisschen so ein Problem bietet. naja, wie kann ich denn eine gute Entscheidung treffen, wenn mir diese Daten dann eben nicht zur Verfügung stehen. Und ich möchte jetzt mal einen Versuch machen, wenn wir jetzt mal die erste These nehmen und mal so die Vorteile von Portfolio-Management. Und wenn wir uns mal jetzt den zweiten Block hier anschauen mit dem Thema maschinellen Lernen. Und da möchte ich euch gerne jetzt mal zusammenbringen. Keine Angst, es wird kein Spiel geben. Aber wie stelle ich mir das jetzt praktisch vor? Der Marc sagt da hier, ich habe da einen Algorithmus, Uli, ich könnte dir helfen, bei deinem Portfolio hier, was weiß ich, von 150 bis 300 Projekten eine Einschätzung vornehmen zu können über eben einen Algorithmus, um festzustellen, was ist da lohnenswert, was nicht. Uli, was wären denn da vielleicht auch deine Erwartungen an so einen Algorithmus, was solltet ihr denn erfüllen aus deiner Sicht? Danach kommen wir gerne noch dazu, Marc, wie du dem Uli denn dann da helfen kannst, ganz praktisch, und wie du da vorgehen würdest. Aber Uli, erstmal vielleicht, was wären denn deine Erwartungen an so eine neuartige Herangehensweise?
Speaker1:[24:09] Bei der Entstehung von solchen Projekten oder gerade bei der Ideation frühzeitig festzustellen, habe ich eigentlich alle meine Daten zur Verfügung, um eine gute Entscheidung zu treffen, um so ein Projekt zu starten. Das wäre für mich Phase Nummer eins. Phase Nummer zwei ist, wenn Projekte starten und laufen, ist halt immer wieder zu verproben, in welchem Gesundheitsstatus befindet sich denn eigentlich das Projekt. Und das halt nicht jetzt rein subjektiv zu treffen, sondern objektiv zu treffen. Wenn vier Parameter, und dafür sind ja genau Algorithmen da, mal bewusst aus verschiedenen Metadaten Dinge zusammenzuführen und zu sagen, guck mal, auf dieses Projekt trifft jetzt ein Muster zu. Das würden wir jetzt mal in deinem Molonen-Beispiel als rot einschätzen, weil es bewegt sich nicht schnell genug, Grundsätze sind nicht genug Ressourcen an Bord. Also das sind ja alles Datenpunkte, die kannst du ganz gut abstimmen. Die hat dann, und das ist halt wichtig bei so einem Machine Learning Algorithmus, der halt dann nicht für bare Münze genommen wird, aber zumindest einen Trägerpunkt schon mal auslöst und sagt, guck mal, ich glaube, wir müssen mal auf das Projekt schauen und vielleicht nochmal mit dem Projekt checken, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Speaker0:[25:21] Ich finde das Stichwort Objektivierung sehr schön. Ich war total begeistert, als ich eure Podcast von Mark Ritzmann gehört habe, wo das Thema Diversität in Denken vorankam. Was er gemacht hat, er hat geöffnet, wie in so einem Board Entscheidungen gemacht werden und auch wie Innovation, sag mal, unterstützt werden kann und getötet werden kann. Wenn ich Diversität von Denken noch eine Stufe weiter ziehen dürfte, dann würde ich sagen, lass doch die Machine Learning Modelle mal an dem Board teilnehmen. Und was meine ich damit? Also die soll nicht voten, sondern die soll einfach sagen, ich habe das auch gelesen, das, was hier jetzt vorliegt, und ich habe auch alle andere Projekte gelesen, die ihr mal diskutiert habt hier, und ich glaube, dass dieses Projekt sehr stark mit Risiken behaftet ist. Oder nicht mit Risiken behaftet ist. Und wenn dann klar gemacht wird, das ist sehr stark mit Risiken behaftet, dann ist man objektiver zu diesem Fazit gekommen und das hat, glaube ich, ein paar Vorteile. Also ein Vorteil ist, dass es nicht eine Person im Bord ist, der sagen muss, ich glaube nicht so an dem Projekt.
Speaker0:[26:30] Das ist total ungünstig, wenn sowas passiert. Wenn einer sagt, ich glaube nicht echt daran und später wird das Projekt trotzdem genehmigt. Also was passiert dann? Jedes Projekt ist irgendwie schwierig und kommt auch in Schwierigkeiten und wenn dann diese Person, der mal gesagt hat, ich glaube nicht so daran, gebraucht wird, dann hat er ein Problem oder sie. Weil er oder sie ist ja ein Mensch und Menschen finden es schön, irgendwie Recht zu haben. Und ich habe schon mal gesagt, ich glaube da nicht dran, das Projekt wird nicht erfolgreich. Und um Recht zu haben, soll er oder sie dann nicht dieses Projekt unterstützen. Es ist sogar politisch vernünftig, es nicht zu unterstützen, weil dann werden die demnächst in dem Board mal zuhören, wenn er sagt, dass ein Projekt gemacht werden soll oder nicht gemacht werden soll. Also die menschliche Komponente ist da total politisch unterwegs. Und Marc Ritzmann hat gezeigt, wie man dagegen steuern kann. Ein Machine Learning Modell hat das überhaupt nicht. Also ein Machine Learning Modell ist nicht politisch unterwegs und gibt einfach nur Indizten. Was man auch machen kann, ist, dass man dann sagen kann, okay, wenn laut Modell da höhere Risiken sind, was tun wir jetzt, um dagegen zu steuern? Also wir verstehen, wir sagen ja zu einem Thema mit einem hohen Risiko. Und das müssen wir also irgendwie anders begleiten als Projekte, die ein niedriges Risiko haben. Welche Instrumente können wir da reinbringen, um dagegen zu steuern?
Speaker2:[27:57] Also du sprichst hier natürlich auch von Vorbehalten, die beim Einsatz von maschinellem Lernen zur Entscheidungsfindung eintreten. Ich finde das nochmal ganz interessant, dass du sagst, was der Marker zählt hat, weil der natürlich auch nochmal auf der einen Seite für ein anderes Führungsverhalten plädiert hat. Und wenn man das jetzt natürlich nochmal paart mit einem Schritt weiter eigentlich, das ist ja nochmal ein Stück proraktiver zu sagen, ist nicht nur das Vertrauen vielleicht in den Mitarbeiter, der die Idee hat oder die Mitarbeiterin, die das da präsentiert und für bestimmte Richtungen plädiert, sondern man nimmt dann eben auch noch die Daten dazu, dann ist das natürlich noch sehr powerful. Und vielleicht ist aber auch noch die Frage, wenn du jetzt an Unternehmen herantrittst oder eher von YouFactive mit einem Modell, was eben durch machinelles Lernen Entscheidungen verbessern soll, unterstützt, da gibt es ja sicherlich Vorbehalte. Wie überzeugst du denn dann Menschen, dass sie sich darauf wirklich berufen sollte? Weil in der Regel ist es ja schon so, Management von Risiken, dass das schon mal gern auch Chefsache ist. Natürlich auch hinterher, sage ich mal, der Chef dann dafür verantwortlich gemacht wird, wenn es eben daneben geht. Das ist bei einer Maschine natürlich schwieriger. Also wie überzeugst du denn dann jemanden davon, dass er so ein Modell nutzen soll, um Entscheidungen zu treffen?
Speaker0:[28:59] Ja, da muss ich an dem Modell denken, wo wir ein Modell gebaut haben, um die Anzahl der Story Points in Agile vorherzusagen. Also wenn du agile arbeitest, da hast du ja User-Stories oder Features, die angegangen werden. Und die Kollegen, die werden dann diese User-Stories, werden die irgendeine bestimmte Gewichtung geben. Also wie viel Arbeit ist notwendig, also wie viel Zeit kostet es, sowas umzusetzen. Und diese Gewichtung, diese Story-Points, so wie die genannt werden, die werden von den Kollegen geschätzt. Also handisch, sag mal menschlich werden die geschätzt. Und später werden die dann eingeplant in diese Programming-Incremments oder in diese Planung, die sie da machen und dann umgesetzt. Das Interessante ist, wir hatten so ein Modell mal etabliert und haben gesagt, lass das mal laufen und lass diese Maschine mal Schätzungen machen, wie viele Storypoints die Maschine denkt, dass es kostet. Und das total Lustige ist, die Maschine ist irgendwie wie Union Berlin oder Red Bull Leipzig, ganz unten angefangen und wird immer besser, besser, besser. Und jetzt gibt es nur noch wenige Menschen, die besser Story Points schätzen können von User Stories, als dass diese Maschine das kann.
Speaker0:[30:14] Am Anfang wurde erst mal gesagt, naja, also die Maschine kann das überhaupt nicht. Und dann wurde erst mal gemessen, wie gut sind wir Menschen eigentlich, weil häufig wissen die Kunden das nicht. Also wir schätzen 20 Story Points oder 40 Story Points, aber wie viel echt dabei rumkommt, das ist häufig unbekannt. Dann wird erst mal quantifiziert, wie gut sind wir eigentlich und wie gut ist dann die Maschine. Und dann sehen wir langsam, dass die Maschine aufsteigt und immer besser wird in der Performance. Und das ist, denke ich, sehr gut für die Akzeptanz, weil irgendwann wird auch gesagt, naja, warum machen wir eigentlich die Schätzungen? Die Maschine macht das ja sowieso besser, als das wir können. In diesem ganz kleinen Umfeld, muss ich sagen, Story Points pro User Story, also nicht in dem riesigen Umfeld, was ist das optimale Portfolio oder was sind jetzt die genauen Risiken, da kann zugesteuert werden, aber in dem kleinen Bereich kann schon sogar Menschenarbeit überflüssig gemacht werden. Also diese blöde Schätzung müssen sie nicht mehr machen. Sie können sich mit den Inhalten beschäftigen und mit welcher Architektur wende ich dafür an, wie sieht die Software optimal aus, wie passt das in mein Sicherheitskonzept. Also die komplexen Sachen, damit können sie sich auseinandersetzen, statt mit einer Schätzung, wie viel Zeit es genau kostet.
Speaker2:[31:25] Uli, was müsste passieren, damit du so einem Modell vertraust und loslässt und die Entscheidungen dorthin abgibst oder dich auf Basis solcher Daten letztendlich beraten lässt, um deine Entscheidungen zu treffen?
Speaker1:[31:39] Gar nicht so viel, lieber Markus. Das Erste für mich ist Offenheit dieser Datenmodelle. Und wie bereits gesagt, solche Modelle wachsen mit ihren Datenpunkten. Also zwei Datenpunkte ergeben eine Linie, ist aber noch kein Trend. Und was für mich natürlich super spannend ist, ist gerade wenn du anonymisierte Daten auch aus anderen Industriebereichen solche Projekte anreicherst und damit natürlich eine viel höhere Datenquelle hast, die halt genau solche Indizien dafür abgeben, wo steht denn eigentlich so ein Projekt. Das wäre für mich Nummer eins. Und Nummer zwei, gib den Machine Learning Algorithmen einen Tisch oder einen Sitzplatz am Tisch. Das ist ja genau das, was Marc eben sagte, nämlich zu sagen, es gibt eine Perspektive, die kommt aus dieser ganz neutralen Datenbewertung und wie gehen wir damit um? Und alleine die Diskussion, daraus zu lernen, wie gehen wir damit um, ist bereits ein großer Benefit, weil die löst so ein bisschen die vielleicht losgetretene Perspektive auf und ergänzt sie. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie im Cockpit. Wir gucken ja auch auf die Instrumente, die uns da so ein paar Sachen vorgeben, wenn wir durch den Himmel fliegen. Und trotzdem
Speaker1:[32:51] Ist es nachher unsere Entscheidung, ob wir rechts oder links fliegen. Und ich glaube, das ist eher so ein zusätzliches Instrument für mich, das objektive Entscheidungen treffen kann. Und je mehr ich loslassen kann, also je mehr ich diese Bestätigung habe, das kann ich jetzt ganz alleine fliegen lassen, desto mehr übernimmt der Algorithmus vielleicht Tätigkeiten, die keinen direkten Mehrwert Richtung Kunde oder Portfolio bringen. Und damit kannst du halt ein Stück weit loslassen. Und da gibt es ja auch so sehr schön, Machine Learning kann ja supervised sein, also betreut sein. Also man guckt, welche Ergebnisse der Algorithmus rausschippt und wir sagen, ja, ist richtig, ist falsch, ist richtig, ist falsch und ergänzen somit quasi die Ergebnisse des Algorithmus oder ich kann ihn ganz ungesteuert laufen lassen. Und quasi sehe, was er oder sie, ich weiß gar nicht, wie nennt man ihn, das Neutrum, der Algorithmus quasi, was er da so produziert, das muss man nur wissen. Auch die Microsoft musste mal ihre Katina zurücknehmen, weil sie plötzlich den Slang gelernt hat. Das ist, wenn man dann halt nicht mehr eingreift. Und ich glaube, das ist dann so eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen, um ganz offen zu sein.
Speaker2:[34:01] Marc, ein Thema, das uns natürlich gerade in den Zeiten aktuell beschäftigt, ist der schonende Einsatz von Ressourcen, natürlich auch aus dem ideologischen Sinne, im Sinne von Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite natürlich aber auch im Sinne von Effizienz. Du sagst ja, dass Machine Learning Ressourcen tatsächlich auch schonen kann. Was ist damit gemeint? Was verstehst du darunter?
Speaker0:[34:23] Also das passt, glaube ich, sehr gut zu dem Beispiel, was ich gerade gegeben habe, wo also so ein Machine Learning Modell schätzt, wie viel Zeit oder so wie viele Story Points eine bestimmte User Story kostet. So ein Modell macht das, indem gelesen wird, was sind jetzt eigentlich die Tätigkeiten, die hier umgesetzt werden müssen. Also da gibt es eine Beschreibung von Anforderungen und diese Anforderungen werden von dem Modell verglichen mit anderen Anforderungen, die früher schon umgesetzt worden sind. Und da, wo sie am nähesten dran ist, dann sagt sie, naja, dann ist das wahrscheinlich auch die Menge von Zeit, die ihr benötigt wird. Was ich total spannend finde, wo das jetzt im Einsatz kommt, ist, dass die Programmierer dann auch sagen, also wie kommt die Maschine jetzt eigentlich zu diesem Fazit? Also welche andere User-Stories haben dazu geführt, dass du denkst, dass das die gleiche Zeit kostet? Also wie hast du die inhaltlich verglichen? Und was wir jetzt tun, ist, wir bieten die inhaltlichen, ähnlichen User-Stories an. Und wir denken ja immer, dass das Programmieren immer neu ist, aber viel von dem, was programmiert ist, wurde schon mal ähnlich umgesetzt. Und was wir durch dieses Modell anbieten können, ist, dass wir sagen, na ja, das, was du jetzt hier bauen wirst, oder was ihr priorisiert habt, ist sehr ähnlich an dem, was wir damals da schon gebaut haben und was da schon operativ ist.
Speaker0:[35:48] Dann können wir als Programmierer sagen, okay, das finde ich interessant, ich gucke mal in den Code, ich gucke mal da drauf, kann ich das nicht anwenden, kann ich da nicht darauf zurückfahren, anstatt dass ich das selber über irgendeine Architektur, die wir definiert haben, versucht so zu entwickeln, wie das damals auch entwickelt wurde, kann ich nicht einfach diesen Code übernehmen und von daraus starten. Und das gibt ja einen Riesenschub, nicht nur bei der Effizienz, sondern auch bei der Ausbildung, weil du kannst dann als Programmierer sehen, wie Probleme auch anders gelöst werden können, als dass du die gelösen wolltest oder möchtest und da halt von dem Reuse lernen und vorankommen, also sich fachlich da entwickeln und fachlich andere Lösungen sehen.
Speaker2:[36:31] Das ist ziemlich faszinierend, manchmal auch ein bisschen ersorgungserregend. Da geht bei mir jetzt gerade so ein bisschen das Kino los, was da vielleicht alles noch möglich ist. Was mir jetzt gerade einfällt, ist natürlich, Willy, uns beschäftigt ja auch sehr stark eben dieses Thema Reuse. Also nicht immer alles irgendwie neu coden, sondern eben so schauen, okay, wo kann man denn bestimmte Fragmente wieder neu einsetzen. Es ist vielleicht sogar denkbar, dass du nicht vielleicht sogar nur die Entscheidungen triffst, sondern dass dir die Maschine direkt sogar den Code liefert oder die Codefragmente, die du benötigst, um eben deinen gewünschten Invest Hast du denn eine gewünschte Software, die du da quasi als Entscheidung voranträgst, zu entwickeln?
Speaker1:[37:04] Auch da, ich glaube, Grenzen gibt es keine, um ganz offen zu sein. Wenn du tatsächlich solche APIs, Codefragmente oder sonst irgendwas gut kategorisierst, also quasi in so eine Art Repository bringst, dann kannst du die natürlich abgreifen und kannst sie natürlich über so einen Code zusammenbringen. Also Machine Learning heißt ja auch nicht nur Mustererkennung, sondern du kannst halt auch Dinge greifen und erweitern. Also das geht schon.
Speaker1:[37:33] Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also ich bin noch ein Stück weit weg von den Science-Fiction-Visionen, dass wir Codes haben, die das alles selber machen und sonst irgendwas. Ich sage immer, solche Machine Learnings treffen wirklich gute Entscheidungen. Wir sehen das selber jetzt im Moment in der Automobilentwicklung, wie viele der Safety-Systeme mittlerweile selbstständige Entscheidungen treffen, ohne dass wir eingreifen, Gefahrbremse und Co. Und wenn ihr jetzt mal an autonomes Fahren denkt, wo ja in so einem Auto mehr als 4000 Sensoren unterwegs sind, die halt genau über solche Algorithmen immer wieder entscheiden, was jetzt getan werden muss, dann ist das ja für uns dafür gebaut, dass es eine Erleichterung bringt. Es ist nicht da, uns abzulösen oder sonst irgendwas, sondern Erleichterung bringt. Ich meine, die größte nicht lösbare Aufgabe eines Machine Learning Algorithmus in einem selbstfahrenden Auto ist ein weißer Kreis um das Auto. Das kriegt der Algorithmus nicht gelöst, weil der kann nicht über die Linie fahren, weil ihr kennt das, Mittelstreifen, Seitenstreifen. Und wenn ihr um ein Auto einen runden Kreis zeichnet, der gleich der weißen Linie auf der Straße ist, dann kommt der Wagen da nicht mehr raus. Nicht mehr alleine. Dann sagt der Algorithmus, geht nicht.
Speaker1:[38:50] Und da braucht es einen Eingriff. Und alleine schon, wenn ich das weiß, weiß ich, dass es gibt Limitierungen. Und ich würde immer die Dinge machen, die sinnvoll sind. Aber es gibt genug Gründe, wo wir eingreifen und damit auch logischerweise einen neuen Pfad gehen und das damit ermöglichen.
Speaker0:[39:10] Ja, Markus, wenn ich das aus der Praxis sehe, dann ist das auch das Thema Kostenschätzungen. Also ja, wir können jetzt Storypoints von User Stories vorhersagen. Können wir von einem Wasserfahrprojekt jetzt sagen, ob das 100.000, 1 Million oder 10 Millionen kostet? Nein, das können wir absolut nicht. Also wir sind da noch nicht. Irgendwann werden wir da kommen, das ist jetzt noch Science Fiction, aber da sind wir absolut noch nicht. Und also wenn ich noch weiter spinne, können wir vorhersagen, ob eine Investition erfolgreich wird, ob das, sag mal, echt bringt, was wir da uns von erhoffen aus diesen Business Cases, wovon Uli gesprochen hat. Da sind wir überhaupt noch nicht. Also das ist noch eine riesen Journey, die wir da vor uns haben. Aber andererseits, ich finde es schön, dass ich noch einen Journey vor mir habe und ich freue mich immer, den Wecker stellen zu dürfen und diese Art von Themen angehen zu dürfen.
Speaker2:[39:57] Ich danke euch beiden. Das war ein sehr spannender Austausch. Wie immer an dieser Stelle ist natürlich die schöne Frage, was habt ihr denn aus dem Gespräch mitgenommen? Was sind so die Themen, die euch nachhaltig beschäftigen? Traditionell fängt natürlich der Uli an.
Speaker1:[40:12] Was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist die Möglichkeiten, normal gibt es ja immer den dritten Mann in so einem ganz fantastischen Film, des vierten Manns oder der Frau, nämlich der Algorithmus, der eine weite Perspektive in die Betrachtung all unserer täglichen Herausforderungen mit einbringt und wie wir das halt gut nutzen. Das ist so mein Takeaway bei all den Möglichkeiten, die so ein Algorithmus drauf hat.
Speaker0:[40:36] Für mich ist es so, dass das Feedback von Uli gibt mir Energie, um weiterzumachen mit diesem Machine Learning. Weil Stichwort Objektivierung, das wurde ja mehrfach heute in den Mund genommen, Objektivierung ist total wichtig, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Und mit Machine Learning können wir da echte große Schritte machen. Also das gibt Energie und richtet aus.
Speaker2:[40:56] Es bleibt noch eine letzte, vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Frage, die wir noch offen haben. Was für ein Geschlecht hat denn eigentlich der Algorithmus, Marc? Hat euer Algorithmus einen Namen?
Speaker0:[41:07] Ja, absolut. Und sie heißt Sandra. Der Grund dazu ist, dass das ein Name ist, der wahrscheinlich in vielen Ländern vernünftig auszusprechen ist. Nicht, weil wir ein Kind der 80er sind und damals eine wunderschöne Sangerin auch Sandra hieß.
Speaker2:[41:23] Also wir halten fest, Sandra sitzt mit am Tisch und damit kommen wir vielleicht ein bisschen weg von unserem Thema und Marc eher zu dir als Person. Wir stellen am Ende ja immer eine ganz besondere Frage, nämlich stell dir vor, du könntest eine Plakatwand direkt vor deiner alten Uni freigestalten, also dort, wo die Studenten rein und raus gehen. Was würdest du den Studentinnen oder Studenten heute mitgeben für ihr Leben oder ihre Laufbahn? Was würde auf dieser Plakatwand stehen?
Speaker0:[41:48] Uli hat von Währung gesprochen. Also was ist die Währung, wo wir Projekte bewerten? Wenn ich das übersetze, dann sind das Ziele. Also was sind die Ziele, die wir im Machine Learning verfolgen müssen? Also wie sollten wir ausgerichtet sein? Und das Interessante ist, dass wir Menschen nicht so gut sind im Stern von Zielen. Also guck dir diese Enron-Pleite an, wo finanzielle Rendite angestrebt wurden und was zu wahrscheinlich dem größten Bilanzbetrug geführt hat, den wir kennen. Wir sind einfach nicht gut im Ziele stecken. Und das habe ich auch gelernt aus Märchen. Also es ist so, dass bei den Märchen, wenn es drei Wünsche gibt, die sie haben, dann ist der dritte Wunsch immer leicht vorhersagbar. Das ist die erste, beide wieder zurückzudrehen. So gehen die meisten Märchen aus. Und weil das so wichtig ist, weil wir so schlecht sind in Ziele stecken, würde ich den Studenten etwas mitgeben wollen, was nicht so ganz einfach ist. Aber trotzdem, was sie vielleicht mal zum Denken bringen soll, und das ist, und was wären die ersten zwei Wünsche, die du gerne erfüllt hättest? Weil ich kenne den dritten Bereich.
Speaker0:[42:55] Wenn wir uns Studenten angucken, was wollen die? Also Studenten möchten gute Noten oder einen Studienabschluss und dann einen schönen Job haben und einen Beitrag liefern oder Geld verdienen oder Karriere machen. Und bei denen, wo dann alles passiert, was da gewünscht wird, Wenn man dann fragt, was möchtest du gerne? Dann ist die Antwort, ich möchte gerne wieder jung sein und an der Uni sein und studieren. Wir können nicht gut Zielen stecken, also üb das bitte mal.
Speaker1:[43:26] Natürlich mag ich Märchen. Das hat ja was Mystisches. Das lädt ja dazu ein, Synapsen im Gehirn anzulocken und nochmal, egal in welchem Altersbereich du dich befindest, nochmal in so einem kindlichen Bereich abzudriffen. Auch eine gewisse Leichtigkeit dahinter. Und das spricht mir auf jeden Fall an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich schon kapiert hätte, Marc, als ich so jung war, was du mir damit hattest sagen wollen, weil das bedeutet schon nochmal eine starke Reflexion mit den Wünschen. Aber ich finde, das hat etwas sehr, sehr Tiefgreifendes. Und gerade wenn du über langfristige Ziele nachdenkst und was du vielleicht gerade perspektivisch kurzfristig denkst, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und ja, doch, sprich mir an.
Speaker2:[44:13] Ich danke euch beiden. Ich glaube, heute sind sehr viele Themen angesprochen worden, die nicht nur Interesse, Inspiration erwecken, sondern vielleicht auch echt Nachfragen zu den Dingen, die ihr da macht bei YouFactive, vor allem eben im Bereich Machine Learning erzeugt haben. Und deswegen die Frage, magst du vielleicht zum Abschluss noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, wo die mehr von dir erfahren können oder wo die vielleicht sogar mit dir mal in Austausch gehen können oder in Kontakt treten können?
Speaker0:[44:34] Ja, komm einfach über LinkedIn auf mich zu, würde ich sagen. Wenn du reinschreibst, dass du dich auf den Digital Base Maker Podcast beziehst, dann werde ich absolut reagieren.
Speaker2:[44:44] Das war der Digital Pacemaker Podcast zum Thema Machine Learning und Entscheidungen. Unser Gast heute war Marc van der Paas. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben möchtet und euch ein bisschen informieren möchtet über die Dinge, die wir heute hier besprochen haben, schaut gerne in die Show Notes. Und wenn ihr Fragen habt oder mit uns diskutieren möchtet, nutzt die Posts und Kommentarfunktionen auf den LinkedIn-Posts. Wir freuen uns auf euer Feedback. Der Digital Pacemaker Podcast erscheint alle 14 Tage am Dienstag bei Spotify, Apple und überall dort, wo du deine Podcasts bekommst. Klicke jetzt auf den Follow- oder Abonnieren-Button, wenn du keine Folge verpassen möchtest. Euch eine gute Zeit und auf bald, euer Uli und Markus.
Speaker1:[45:25] Rock’n’Roll!
Music:[45:25] Music
Speaker1:[45:35] Der Digital Pacemaker Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.